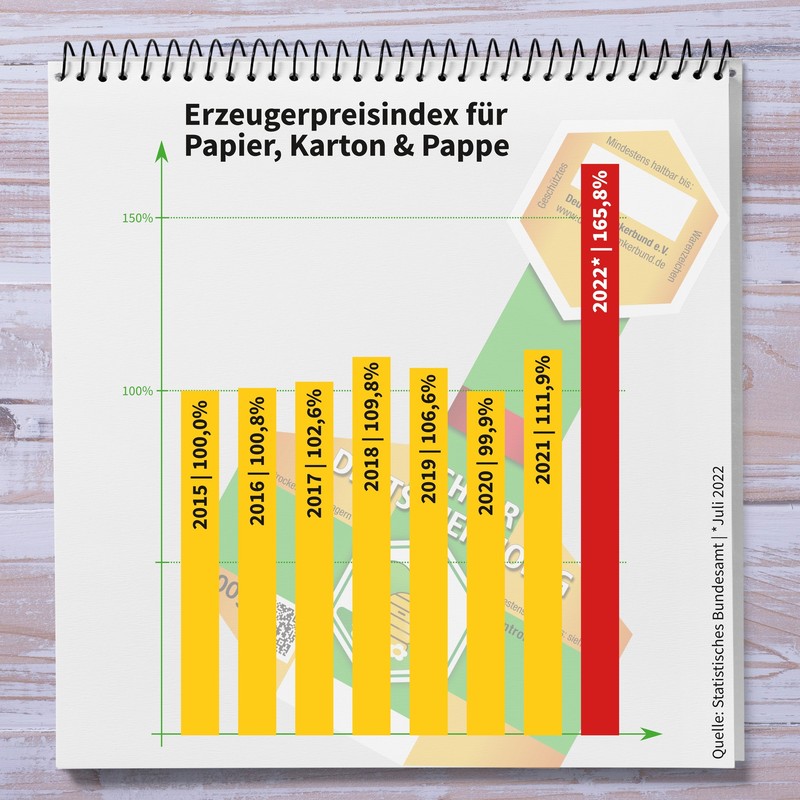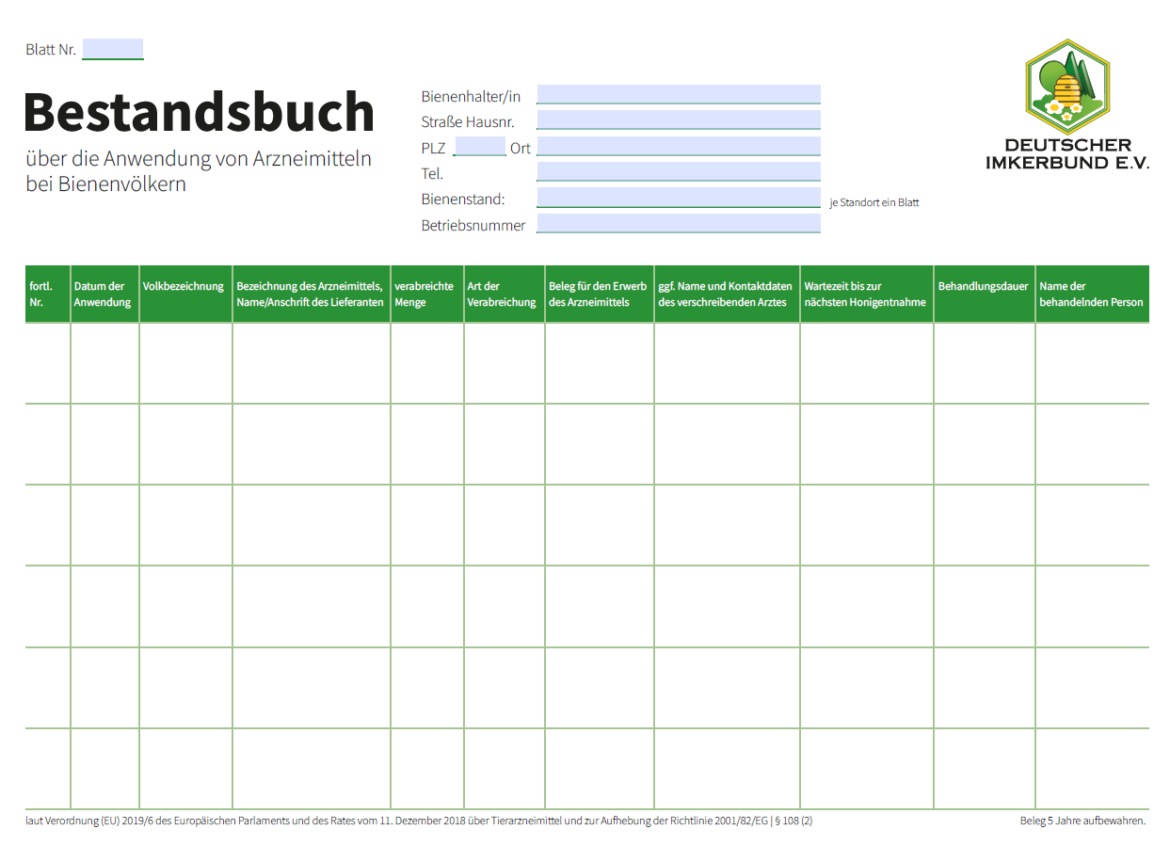Meinung zum Honigtest von Stiftung Warentest 4/2025
14.04.2025 Grundsätzlich halten wir es für positiv, dass Stiftung Warentest auch Honig unter die Lupe nimmt. Allerdings setzt Stiftung Warentest leider einige Maßstäbe für seine Bewertung an, die den rechtlichen Rahmen nicht berücksichtigen beziehungsweise die Honigqualität nicht richtig darstellen. Die Ergebnisse des Tests bilden somit leider nicht eindeutig die hohe Qualität des heimischen Honigs ab. Im Test wurden unter anderem zwei Honige untersucht, die von Abfüllern unter der Marke ECHTER DEUTSCHER HONIG abgefüllt wurden. Die große Mehrheit der Honige mit unserer Marke wird direkt von der Imkerin oder dem Imker selbst abgefüllt. Individuelle Beurteilung des Begriffs „Spitzenqualität“ Die Abwertung der Honige unter der Marke ECHTER DEUTSCHER HONIG war vor allem darin begründet, dass Stiftung Warentest den Etikettenaufdruck „Spitzenqualität“ als besondere „Premium“-Auslobung angesehen hat. Die Abwertung ist nicht gerechtfertigt, da bislang kaum eine staatliche Lebensmittelkontrollstelle den Aufdruck „Spitzenqualität“ mit „Premium“ gleichgesetzt hat. Aufgrund einzelner Beanstandungen haben wir allerdings bereits im vergangenen Jahr reagiert. Die Etiketten gibt es nun mit unterschiedlichen Aufdrucken. Imkerinnen und Imker, die weiterhin den Aufdruck „Spitzenqualität“ wählen, sollten darauf achten, dass ihre Honige die strikteren Werte für Invertase und HMF erfüllen. In den meisten Fällen sollte das der Fall sein, aber wir empfehlen auf jeden Fall eine vorherige Laboranalyse. Wir erwarten weiterhin von allen Nutzerinnen und Nutzern unserer Marke, dass sie stets die beste Qualität abfüllen. Wir führen daher anlässlich der Testergebnisse auch Gespräche mit den Abfüllern. Kein echter Vergleich von Honigqualität Von Importhonigen wird in der Regel nicht die Invertase-Aktivität gemessen. Invertase ist ein hitzeempfindliches Enzym, das einen Gradmesser für eine schonende Behandlung und die Naturbelassenheit des Honigs darstellt. Die Einhaltung einer bestimmten Invertase-Aktivität ist Pflicht für Honig unter der Marke ECHTER DEUTSCHER HONIG. Auf diese Weise garantieren wir eine höhere Qualität des heimischen Honigs. Bei Importhonigen wird hingegen die Invertase-Aktivität nicht gemessen. Die große Mehrheit würde hier die Anforderungen nicht erfüllen. Importhonige halten meist nur die niedrigen gesetzlichen Diastase-Werte ein. Das wenig empfindliche Enzym Diastase übersteht beispielsweise problemlos die Pasteurisierung der Importhonige. Auch die gesetzlichen HMF-Werte, die ebenfalls einen Hitzeschaden anzeigen sollen, sind recht hoch angesetzt. Damit ein heimischer Honig auch nur in die Nähe des kritischen Bereichs der gesetzlichen Diastase- und HMF-Werte kommt, muss er schon stark geschädigt sein. Diese Werte sind folglich keine guten Kennzahlen für Naturbelassenheit. Mit Honigen, die nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen müssen, kann bereits allerhand geschehen sein. Leider war das Stiftung Warentest offenbar nicht ganz bewusst. Bis ein Honig aus Südamerika oder Asien im Glas im Supermarkt landet, vergehen lange Zeiträume. Das hat mit „frischem Honig“ nichts mehr zu tun. Ein offener Vergleich zwischen Imker- und Importhonigen würde sicherlich zeigen, dass die Honige aus heimischen Imkereien in der Regel schonender behandelt werden und im Gegensatz zu Discounter-Honigen naturbelassen sind. Umweltaspekte nicht gewertet Leider wurde einigen wichtigen Aspekten im Test keine Aufmerksamkeit gewidmet: Heimische Honige weisen durch kürzere Transportwege und geringere Bearbeitung sicherlich einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck auf als Importhonige. Es mag inzwischen abgedroschen klingen, aber es gilt immer noch: Bestäubungsleistung lässt sich nicht importieren. Solche Punkte sollten bei der Kaufentscheidung heutzutage eine wichtige Rolle spielen. Schulnoten für Sensorik sind in dem Test unsinnig Ein Honig der Marke ECHTER DEUTSCHER HONIG wurde abgestuft, da es sich um Rapshonig handelte, der als Blütenhonig ausgewiesen war. Die Beanstandung der Sensorik-Ergebnisse widerspricht den Vorgaben der Honigverordnung. Eine allgemeinere Sortenbezeichnung ist bei Honig immer rechtens. Zudem haben Blütenhonige keinen einheitlichen Geschmack, der sich standardmäßig vergleichen lässt. So kann Blütenhonig einen Einschlag bestimmter Nektar- oder Honigtauquellen mit starkem Eigengeschmack aufweisen. Man kann bei den Honigen im Test nur bewerten, ob der Geschmack honigtypisch ist. Ist dies der Fall, hat der Honig bestanden. Andernfalls ist er nicht verkehrsfähig. Schulnoten ergeben hier keinen Sinn. Unklare Ursprungsangabe nicht abgewertet Die Tatsache, dass Stiftung Warentest die völlig unklare Ursprungsangabe „Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern“ unter dem Punkt „Deklaration“ nicht abgewertet hat, ist angesichts der übrigen Entscheidungen unverständlich. Die schwammige Angabe ist zwar erlaubt, hat aber nichts mit Verbraucherinformation zu tun. Zum Glück wird diese Angabe auch aufgrund der intensiven Arbeit des Deutschen Imkerbundes, der als einziger deutscher Verband viel Zeit in die Verhandlungen der EU-Honig-Richtlinie investiert hat, ab nächstem Jahr Geschichte sein. Tests auf Verfälschungen Da dies eine eigene größere Diskussion darstellt, werden wir uns dazu in Kürze getrennt äußern. Zum Originalartikel: https://deutscherimkerbund.de/meinung-zum-honigtest-von-stiftung-warentest-4-2025/